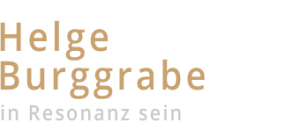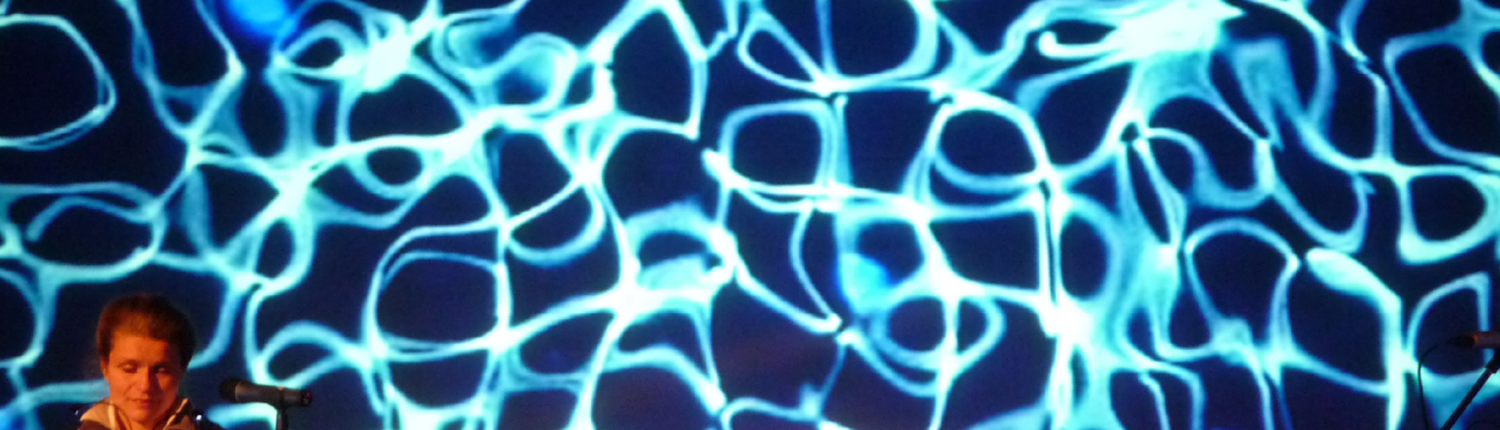Aktuelle Konzertprojekte
DREIKÖNIGSORATORIUM
Oratorium für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Sprechstimme, Bläser-Trio, Streichquartett, Schlagwerk, Orgel, Schola und Chöre von Helge Burggrabe
LUX IN TENEBRIS - Friedensoratorium
Oratorium aus Klang, Text und Licht für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Sprechstimme, Streichquartett, Bläsertrio, Schlagwerk, Orgeln, Schola und Chöre von Helge Burggrabe
Ein Werk über Krieg und Zerstörung und der Sehnsucht nach Frieden. Und damit ein Werk über den Fall des Menschen in die Dunkelheit und der Suche nach dem Licht. Im Mittelpunkt steht das biblische Drama von Kain und Abel und die Frage, ob der Bruder im Gegenüber noch den Bruder sehen kann? LUX IN TENEBRIS macht die Stufen von Entfremdung zu Hass bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen erlebbar und entwickelt mit Kernaussagen des Neuen Testaments die Vision eines anderen Miteinanders.
Das Libretto hat Helge Burggrabe in Zusammenarbeit mit dem Theologen Dr. Reinhard Göllner und der Journalistin Angela Krumpen verfasst.
Werkgeschichte:
Das Oratorium LUX IN TENEBRIS wurde als Auftragswerk zum 1200-Jahr-Jubiläum des Bistums Hildesheim am 14.-17. Mai 2015 im Hildesheimer Dom uraufgeführt und aufgrund des großen Erfolges drei weitere Male im Jahr 2017. Es folgte 2019 eine Aufführung im Dom zu Stendal unter der Leitung von Domkantor Johannes Schymalla und am 8. Mai 2020 sollten zeitgleich im Kölner Dom und im Bremer Dom große Gedenkkonzerte zu “75 Jahren Ende des 2. Weltkrieges” stattfinden, was wegen Corona abgesagt wurde. Im Bremer Dom wurde die Aufführung 2022 unter der Leitung von Domkantor Tobias Gravenhorst nachgeholt. Ein Konzertprojekt, das Musik und Spiritualität verbindet.
Von LUX IN TENEBRIS liegt eine CD-Aufnahme (mit DVD) der Hildesheimer Aufführung 2017 vor, die hier im Online-Shop bestellt werden kann. Mitwirkende sind: Martina Gedeck (Rezitation), ELBTONAL Percussion, Geraldine Zeller (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Manuel König (Tenor), KMD Helmut Langenbruch (Orgel), Streichquartett, Bläsertrio, Domchor, Kammerchor, Mädchenchor und Schola der Hildesheimer Dommusik unter der Leitung von Dommusikdirektor Thomas Viezens und Domkantor Dr. Stefan Mahr; Licht- und Videokunst: Michael Suhr und media.plus X.
Ebenso ist eine Studienpartitur (Buch in Din A4) und eine Partitur für Dirigent*innen im Online-Shop bestellbar. Wegen Aufführungsrechten und Leihmaterial für Chor und Orchester wenden Sie sich bitte gerne an das Kulturbüro Burggrabe, kontakt@burggrabe.de.
STELLA MARIS – Blaues Oratorium
Ein Oratorium für Mezzosopran, Klarinette, Violoncello, Sprechstimme, Jugendchor, Kammerchor, Orgel, Marimbaphon, Tam-tam, Becken, Röhrenglocken, Trommel, Wasserinstrumente, WasserKlangBilder und Lichtkunst von Helge Burggrabe
Stella Maris ist ein Marienoratorium, das aus Anlass der 1000-Jahr-Feierlichkeiten in Chartres von Helge Burggrabe komponiert und am 8. September 2006 als europäisches Kulturprojekt unter der Schirmherrschaft der Botschafter von Frankreich und Deutschland in der dortigen Kathedrale uraufgeführt wurde. Libretto und Musik stellen einen Brückenschlag dar von Alt und Neu, von Überliefertem und neu Entwickeltem. Im Mittelpunkt stehen die Frauenfiguren Maria und Sophia, erzählt wird die Handlung von einer Sopranistin, einer Sprecherin, Instrumentalsolisten und Chören. Durch die Einbeziehung von Architektur, Musik, Sprache und den Dialog von Klang und Wasser entsteht eine Synästhesie, die das Publikum auf allen Ebenen der Wahrnehmung anspricht.
Zu Beginn des Werkes tritt Sophia auf, von der die Bibel berichtet, dass sie bereits vor Erschaffung der Welt an der Seite Gottes weilte. Die Sängerin (Sopran) trägt eine blaue Scheibe aus Chartreser Glas und stellt sich als personifizierte Weisheit vor. Es folgen Vertonungen von Ausschnitten der Genesis, die vom Urmeer und der Erschaffung des Lichts handeln, bevor Maria (Rezitation) zum ersten Mal erscheint. Maria spricht stellvertretend für eine Frau aus der heutigen Zeit Monologe im Stil von Tagebucheinträgen. Auf einer zweiten, universellen Erzählebene werden Texte aus dem „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke in Form von Soloarien (Sopran) vorgetragen. Zusammen mit den Chorstücken „Je suis le silence I-III“ bieten sie Raum für weiterführende Reflexionen. Weiterhin zitiert das Libretto aus dem biblischen Gesang der Maria „Magnificat“ und greift einen Marientext des Chartreser Gelehrten Fulbert (um 1.000 n. Chr.) auf.
Wie die Handlung lebt auch die Musik von der Polarität zwischen Alt und Neu, indem sie gregorianische Elemente mit einer neueren Musiksprache verbindet. Das von Solisten und Chor gesungene Wort wird instrumental durch die solistischen Melodielinien von Cello und Blockflöte einerseits und die Klangfülle der Orgel andererseits weitergeführt.
In dem Marienbegriff Stella Maris klingen zwei zentrale Elemente an: Licht und Wasser. Daher unterstützt ein Lichtkonzept die Handlung des Oratoriums und schafft außerdem neue Raumerlebnisse durch dezent eingesetztes Architekturlicht. Der Wasser-Aspekt wird realisiert von dem Künstler Alexander Lauterwasser, der mit seinen Bildern den Dialog von Klang und Wasser sichtbar macht. Bei der von ihm entwickelten Wasserklang-Projektion wird ein mit destilliertem Wasser gefülltes Gefäß von unten her mittels eines speziellen Schallwandlers durch die Klänge der Musik zum Schwingen gebracht. Über Lichtreflektionen werden die Verteilungen und Wanderungen der Wellenbewegungen sichtbar gemacht, gefilmt und auf eine Leinwand projiziert. Es ist ein Konzertprojekt, das Kunst, Musik und Spiritualität verbindet.
Werkgeschichte
Das Oratorium Stella Maris wurde als europäisches Kulturprojekt am 8. September 2006 in Chartres und am 10. September 2006 in Hamburg als deutsch-französisches Doppelkonzert mit 70 Künstlern aus beiden Ländern uraufgeführt. Der deutsch-französische Fernsehsender ARTE begleitete die Uraufführung und erstellte einen Dokumentarfilm, der seither in mehreren Ländern ausgestrahlt wurde.
Bereits mit der Hamburger Aufführung wurde klar, dass Stella Maris zwar als Hommage an die Kathedrale von Chartres entstanden war, aber durch seinen universellen Ansatz auch in anderen Kirchenräume seine Wirkung entfalten kann und stimmig inszeniert werden kann. So folgten 2007 zwei Aufführungen im Mariendom Neviges, in Europas größtem Sakralbau der Moderne, und 2008 dann eine Aufführung im Hohen Dom zu Köln mit mehr als 3.500 Besuchern. Weitere Aufführungen folgten 2011 in der Dresdner Frauenkirche, 2012 im Kaiserdom Königslütter, 2016 als deutsch-französisches Kulturprojekt im Dom zu Speyer und in der Kathedrale von Chartres und 2017 im Fraumünster Zürich.
Mit dem Ziel, dass Stella Maris noch größere Kreise ziehen möge, wurde im Herbst 2011 die Stiftung Stella Maris Foundation gegründet. Nähere Informationen sind unter www.stellamarisfoundation.com zu finden.
Dokumentarfilm, Konzertverfilmung (2008, DVD) und neue CD-Aufnahme (2020)
Von dem Werk Stella Maris liegt seit 2008 eine Doppel-DVD mit zwei Filmen vor, die im Label Hänssler Classic erschienen ist. Ein knapp einstündiger Dokumentarfilm zeigt die Premiere in Chartres mit Hintergrundberichten, Interviews, Architekturbildern und Konzertausschnitten. Dieser Film wurde von NDR TV und Arte TV produziert und mehrfach im Fernsehen unter dem Titel „Ein Marienoratorium für die Kathedrale von Chartres“ ausgestrahlt. Mitwirkende Künstler sind Hiam Abbass, Graciela de Gyldenfeldt, Emmanuelle Bertrand, Helge Burggrabe, Patrick Delabre, Alexander Lauterwasser, Michael Batz, der Harvestehuder Kammerchor und der Chartreser Jugendchor La Maîtrise unter der Leitung von Dirigent Claus Bantzer. Da die DVD inzwischen vergriffen ist und nicht mehr neu aufgelegt wurde, ist der Dokumentarfilm auf Youtube nun kostenlos anschaubar.
Ein weiterer Film zeigt das Oratorium Stella Maris ungekürzt in seiner Konzertfassung, aufgenommen im Mariendom Neviges, einer der größten modernen Kirchen. Mitwirkende hierbei sind Iris Berben, Maria Jonas, Emmanuelle Bertrand, Helge Burggrabe, Winfried Bönig, Alexander Lauterwasser, Mario Klapper, das Vokalensemble Kölner Dom und Knaben des Kölner Domchores unter der Leitung von DKM Eberhard Metternich. Die DVD enthält zudem ein Gespräch zwischen Iris Berben und Helge Burggrabe über das Projekt Stella Maris und ist zur Zeit jedoch vergriffen.
Seit dem Frühjahr 2020 liegt eine Ersteinspielung von STELLA MARIS auf CD vor, ebenfalls veröffentlicht von dem Label Hänssler Classic. Diese Aufnahme entstand im romanischen Dom zu Speyer mit der Filmschauspielerin Julia Jentsch, mit Alexandra Busch (Mezzosopran), Olivia Jeremias (Cello), Jochen Bauer (Klarinette), Heidi Merz (Perkussion), Markus Eichenlaub (Orgel), mit dem Vokalensemble Dom zu Speyer und Mitglieder des Mädchenchores am Dom zu Speyer und der Speyrer Domsingknaben. Die musikalische Gesamtleitung hatte Domkapellmeister Markus Melchiori. Diese Doppel-CD ist erhältlich im Online-Shop.
Ebenso ist eine Studienpartitur (Buch in Din A4) und eine Partitur (Din A3) für Dirigent*innen im Online-Shop bestellbar. Wegen Aufführungsrechten und Leihmaterial für Chor und Orchester wenden Sie sich bitte gerne an das Kulturbüro Burggrabe, kontakt@burggrabe.de.
JEHOSCHUA – Rotes Oratorium
Ein Oratorium für Sopran, Alt, Tenor, Violoncello, Klarinette, Sprecher, Marimba, Vibraphon, Tamtam, Trommel, Röhrenglocken, Kammerchor und Streichorchester von Helge Burggrabe
Ausgangspunkt des Werkes sind die im hebräischen Namen JEHOSCHUA (= Jesus) enthaltenen Vokale
I – E – O – U – A, die auf der Ebene der Sprache und des Klanges das Thema des Oratoriums aufgreifen und erlebbar machen können: Es geht um Menschwerdung und Inkarnation, eine geistlich-philosophische Grundfrage, die mit der Farbe Rot verbunden werden kann. So bedeutet beispielsweise das hebräische Wort adāmā sowohl “Erdboden“ als auch “Röte“ und ist zugleich die sprachliche Wurzel für den Namen des ersten (biblischen) Menschen überhaupt: Adam. Auch in der Malerei und Glaskunst des Mittelalters ist die Farbe Rot im geistlichen Kontext häufig ein Verweis auf Inkarnation und Manifestation bis hin zur Metapher für das Blut Jesu.
Die Struktur des Oratoriums greift über die spezielle Vokalfolge den Inkarnationsgedanken auf: Es beginnt mit dem hellen Vokal I, geht über die Vokale E und O bis zum dunklen Vokal U und endet schließlich mit dem öffnenden Vokal A und dem Bibelzitat (Joh. 1,14): „Und das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns.“ Da jedem Vokal ein eigener Resonanzbereich im menschlichen Körper zugeordnet werden kann, entspricht die Vertonung der Vokal-Reihenfolge gewissermaßen einem Hineinsinken der Musik in den eigenen Körper. Der Vokal A mit seinem Resonanzraum “Herz“ kommt am Ende dieses musikalischen Inkarnationsprozesses und kann als Aufrichtung und Öffnung erlebt werden.
Das Libretto des Theologen Kurt Dantzer ordnet den fünf Vokalen biblische Geschichten, Psalmgebete, Betrachtungen, Dialoge und Anrufungen zu, die den Weg des göttlichen Wortes zu den Menschen und den Weg der Wandlung des Menschen beschreiben. Dabei stehen fünf zentrale Begegnungsgeschichten Jesu aus den Evangelien im Mittelpunkt, die reflektiert, respondiert und weitergeführt werden.
Vom Aufbau her ist das Werk an die Oratorien-Tradition angelehnt: So werden die Texte und Aussagen von Solisten und Chor in Form von Rezitation, Arien und Chorälen vorgetragen, begleitet von einem Streichorchester. Hinzu kommen solistisch eingesetzte Klarinette und Cello, die das Geschehen kommentieren, sowie besondere Klangfarben und rhythmische Elemente durch diverse Perkussionsinstrumente.
Im Vordergrund der Vertonung steht der Ritual-Charakter. Ein Gong eröffnet und beschließt das Werk. Nachdem im Prolog das Wort, der Klang und die Kernsätze eingeführt wurden, folgen fünf Kapitel mit jeweils in sich ähnlichem, rituellem Aufbau.
Bei Aufführungen von Jehoschua kommt der Verbindung von Sprache, Musik und dem Raum eine wichtige Bedeutung zu: Der Aufführungsort soll gewissermaßen mit seinem gebauten Architektur-Leib selbst in Dialog und Resonanz treten und die Geschichte miterzählen. Ziel ist eine Verbindung von Stille, Musik und Spiritualität.
Das Kulturprojekt Jehoschua war ein gemeinsames Auftragswerk des Loccumer Arbeitskreises für Meditation und des Diakoniekonvents Lutherstift in Falkenburg bei Oldenburg. Jehoschua wurde am 10. Mai 2008 in Hannover in der Neustädter Hof- und Stadtkirche uraufgeführt mit weiteren Aufführungen in Nienburg und Ganderkesee statt. Das ganze Projekt stand dabei unter der Schirmherrschaft des damaligen Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Christian Wulff. Im Jahr 2009 wurde Jehoschua im Bremer Dom und in der Blankeneser Kirche in Hamburg aufgeführt sowie in einer kammermusikalischen Bearbeitung des Pianisten Henning Lucius an der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Im Rahmen der Hamburger Aufführung erfolgte die Ersteinspielung des Werkes, die 2010 von dem Münchner Label OehmsClassics als Doppel-CD veröffentlicht wurde. 2011 wurde das Werk erstmals mit einer TanzPerformance verbunden, die der israelische Choreograph und Tänzer Lior Lev realisierte. Das zentrale Thema des Werkes, Menschwerdung und Inkarnation, wird dabei nicht nur auf musikalisch-sprachlicher Ebene erzählt, sondern auch durch den Körper eines Menschen ausgedrückt. So wird das Prozesshafte auch visuell: Vor den Augen der Konzertbesucher entwickelt es sich aus dem Moment heraus. 2012 folgten Aufführungen der Kölner Dommusik unter der Leitung von Eberhard Metternich im Hohen Dom zu Köln und in der Kathedrale von Chartres.
Pressereaktionen zu Jehoschua können hier nachgelesen werden.
CD-Einspielung
Das Werk Jehoschua liegt seit März 2010 als CD-Veröffentlichung vor. Die Interpreten dieser von dem Münchner Label OehmsClassics produzierten Ersteinspielung sind Olivia Jeremias (Cello), Johannes Peitz (Klarinette), Geraldine Zeller (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Manuel König (Tenor), Marek Reimann (Perkussion), Christoph Bantzer (Rezitation) sowie der Harvestehuder Kammerchor und das Ensemble Resonanz unter der Leitung von Dirigent Claus Bantzer.
Die Doppel-CD ist im Handel oder direkt hier im Online-Shop erhältlich.
KONZERT DER STILLE
Konzertprogramm für Flöte, Sopran, Cello, Klavier, Lichtkunst und Rezitation
Was ist Stille? Dieser Frage soll auf poetische Weise mit Sprache und Musik nachgegangen werden: Ausgehend von dem „Hymnus der Stille“, bei dem die Stille selbst zu sprechen beginnt, werden Texte von John Cage, Friedrich Nietzsche, Friedrich Hölderlin, Rumi, Rainer Maria Rilke und Rose Ausländer zu Gehör gebracht. Die Vertonungen für Solisten und Chor von der Gregorianik einer Hildegard von Bingen bis zu neuen Kompositionen von Helge Burggrabe versuchen die Grenze zwischen Stille und Klang, aber auch die Fülle und Lebendigkeit von Stille erlebbar zu machen. Entdeckt werden soll eine Stille, die mehr ist als nur die Abwesenheit von Geräuschen. Die Musizierenden beziehen dabei den gesamten Kirchenraum mit ein, ändern ihre Spielpositionen und ermöglichen so dem Publikum ein besonderes akustisches Raumerleben. Unterstützt von einer dezent eingesetzten Lichtkunst entsteht eine Hommage an den jeweiligen Kirchenraum, die neue und überraschende Sichtweisen ermöglicht. Es ist ein Konzertprojekt, das Stille, Musik und Spiritualität miteinander verbindet.
Ausführende: Helge Burggrabe (Flöten), Geraldine Zeller (Sopran), Olivia Jeremias (Cello), Michael Suhr (Lichtkunst) in Zusammenarbeit mit einem Kammerchor, Organisten und Rezitator.
Werkgeschichte
Nach ersten Konzerten 2006 in der Ulmer Georgskirche, 2007 in St. Maria im Kapitol in Köln, 2008 in der Klosterkirche Heiligkreuztal und 2009 in der Hamburger Kirche der Stille wurde das Konzert der Stille aufgrund der großen Resonanz seit 2010 in zwanzig weiteren Kirchen in Deutschland, Italien und der Schweiz aufgeführt. Darunter waren der Verdener Dom, die Heiliggeistkirche in Heidelberg, der Bad Gandersheimer Dom, das Berner Münster und das Pantheon in Rom. 2013 wirkte bei zwei Aufführungen der Artist CARISMO. Vergleichbar dem akustischen Ansatz ging es auch auf visueller Ebene darum, eine Stille zu entdecken, die mehr ist als die Abwesenheit von Bewegung.
Konzertverfilmung (DVD)
Ende März 2011 erschien das KONZERT DER STILLE als Filmaufnahme der Bad Gandersheimer Aufführung auf DVD und ist im Online-Shop erhältlich. Dabei wird die besondere Verbindung von Musik, Sprache, romanischer Architektur, Lichtkunst und Stille erlebbar. Mitwirkende sind: Geraldine Zeller (Sopran), Olivia Jeremias (Cello), Helge Burggrabe (Flöten, Konzept), Henning Scherf (Rezitation), Kammerchor Wernigerode, Leitung: Rainer Ahrens, Lichtgestaltung: Michael Suhr. Ein Trailer mit Filmausschnitten der DVD kann hier angeschaut werden.